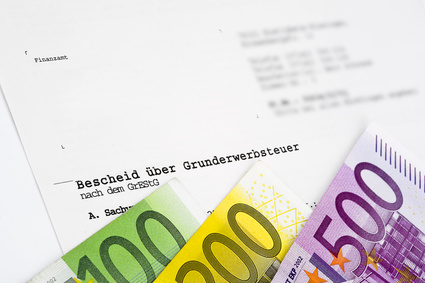Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 04.06.2025 (II R 47/22) entschieden, dass Zahlungen für die Übernahme eines Ökokontos beim Grundstückskauf in Nordrhein-Westfalen zur grunderwerbsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage zählen. Diese Entscheidung betrifft vor allem den Erwerb von Flächen im Rahmen naturschutzrechtlicher Flurbereinigungsverfahren.
Zum Hintergrund
Ein „Ökokonto“ ist kein Geldkonto, sondern eine Dokumentation von „Ökopunkten“, die durch vorzeitige Ausgleichsmaßnahmen in Natur und Landschaft erzielt werden. Das Ziel ist es, die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zu flexibilisieren. So können Gemeinden frühzeitig Ausgleichsflächen schaffen, bevor konkrete Bauprojekte anstehen. Wenn ein Bauvorhaben zu Eingriffen in die Natur führt, können die benötigten Ökopunkte von diesem Ökokonto entnommen werden, anstatt dass der Vorhabenträger die Maßnahme selbst durchführen muss.
Ökokonto als Teil des Grundstücks
Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand die Frage, ob die Zahlung für ein mit dem Grundstück verbundenes Ökokonto als eigenständige, grunderwerbsteuerfreie Leistung zu behandeln ist oder ob sie Teil der Bemessungsgrundlage für die Steuer darstellt. Die Klägerin (eine Stiftung) hatte im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens Grundstücke in NRW erworben und hierfür neben dem Kaufpreis auch einen Betrag für die Übernahme eines Ökokontos entrichtet. Das Finanzamt rechnete diese Zahlung zur steuerpflichtigen Gegenleistung hinzu, wogegen sich die Stiftung mit ihrer Klage und anschließenden Revision wandte.
Kein eigenständiges Wirtschaftsgut
Der BFH folgte der Argumentation des Finanzamts und des Finanzgerichts Münster. Das Ökokonto, so der Senat, stelle keinen vom Grundstück losgelösten Vermögenswert dar. Vielmehr sei es ein behördlich anerkannter naturschutzrechtlicher Zustand des Grundstücks, der mit diesem fest verbunden sei. Die darin verbuchten Ökopunkte seien kein eigenständig handelbares Gut, sondern nur insoweit „übertragbar“, wie sie durch Dritte zur Erfüllung von Kompensationspflichten genutzt werden können, stets jedoch unter Nutzung des betreffenden Grundstücks.
Maßgeblich ist das Landesrecht
Da die Ökokonto-Verordnung NRW keine Möglichkeit zur freien Übertragung von Ökopunkten ohne Einbeziehung des Grundstücks vorsieht, sind diese aus Sicht des BFH untrennbar mit dem Grundbesitz verbunden. Die Zahlung für das Ökokonto dient daher unmittelbar dem Erwerb des Grundstücks und unterliegt damit der Grunderwerbsteuer. Die von der Klägerin herangezogenen Parallelen zu Fällen von Weihnachtsbaumbepflanzungen oder Eigenjagdrechten wies der BFH zurück, da es hier nicht um temporär mit dem Grundstück verbundene Nutzungen gehe, sondern um einen dauerhaft festgeschriebenen naturschutzrechtlichen Zustand.
Fazit
Das Urteil stärkt die Position der Finanzverwaltung bei der Auslegung der grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrundlage. Erwerber von Grundstücken mit Ökokonto-Anbindung müssen künftig damit rechnen, dass auch dafür geleistete Zahlungen steuerlich berücksichtigt werden, jedenfalls solange Landesrecht wie in NRW eine enge Verbindung zwischen Grundstück und Ökopunkten vorsieht.