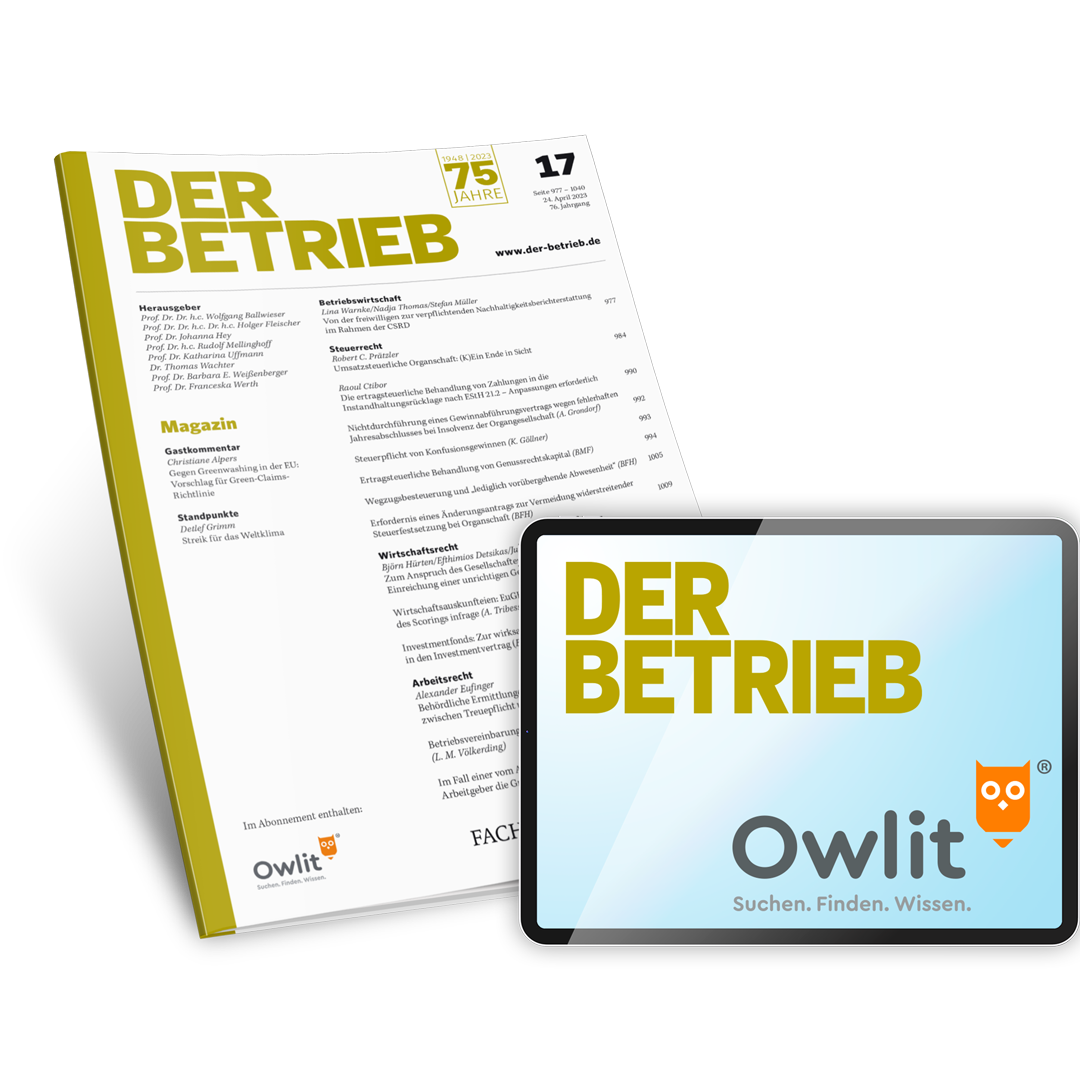I. Aktuelle Gesetzeslage und praktische Auswirkungen
Grundsätzlich können negative Einkünfte in künftige Jahre vorgetragen und dort mit Gewinnen verrechnet werden (sog. Verlustvortrag). Die gesetzlichen Regelungen sehen eine zeitliche Streckung des Verlustvortrags bei der Körperschaft- und der Gewerbesteuer vor. Der Verlust aus einem vorangegangenen Wirtschaftsjahr kann nur bis zu 1 Mio. € vollständig abgezogen werden. Darüber hinaus noch bestehende Verluste können nur bis zu 60% des zu versteuernden Einkommens des entsprechenden Veranlagungszeitraums abgezogen werden. Durch das Wachstumschancengesetz wurde die Verlustvortragsmöglichkeit für die Jahre 2024 bis 2027 auf 70% erhöht. Im Endeffekt kann es somit trotz vorhandener Verluste zu einer Besteuerung kommen, da nach erfolgtem Verlustvortrag noch ein positives Einkommen verbleiben kann. Dieses Phänomen wird daher auch als Mindestgewinnbesteuerung bezeichnet.
Besonders offensichtlich wird das Ergebnis in Konstellationen, in denen die Verluste aufgrund eines Insolvenzverfahrens und der Auflösung einer Kapitalgesellschaft in der Folgezeit nicht mehr vollständig genutzt werden können und es somit zu einem Definitiveffekt kommt. Das folgende, leicht vereinfachte Beispiel skizziert die Auswirkungen der Mindestgewinnbesteuerung:
Eine GmbH hat im Jahr 01 einen körperschaftsteuerlichen Verlust in Höhe von 2 Mio. € erzielt, der gesondert festgestellt wird. Im Folgejahr 02 erwirtschaftet sie ein körperschaftsteuerliches Einkommen von 2 Mio. €. Dieses kann sie in Höhe von 1 Mio. € vollständig mit dem Verlustvortrag verrechnen, in Höhe des übersteigenden Betrags jedoch nur zu 70% (0,7 Mio. €). Daraus ergibt sich ein positives Einkommen von 0,3 Mio. € und es verbleibt ein Verlustvortrag von 0,3 Mio. €. Wird die GmbH Ende des Jahres 02 beendet, geht dieser Verlustvortrag ungenutzt unter. Obwohl die GmbH in den beiden Jahren saldiert betrachtet insgesamt keinen Gewinn erwirtschaftet hat, muss sie 0,3 Mio. € versteuern. Aufgrund der Liquidation der GmbH kann der Verlust nicht mehr verrechnet werden; daher spricht man vom Definitiveffekt.
II. Entscheidung des BVerfG
Der BFH hatte dem BVerfG in seinem Vorlagebeschluss vom 26.02.2014 (I R 59/12) die Frage gestellt, ob die Mindestgewinnbesteuerung in § 8 Abs. 1 KStG i.V.m. § 10d Abs. 2 EStG, § 10a Satz 1, 2 GewStG gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt. Zwar ging der BFH einerseits davon aus, dass die Mindestgewinnbesteuerung in ihrer Grundkonzeption der zeitlichen Streckung von Verlustvorträgen grundsätzlich verfassungskonform ist. Gleichzeitig war er jedoch davon überzeugt, dass die Regelungen wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungswidrig sind, soweit durch den Ausschluss eines Verlustausgleichs ein Definitiveffekt eintritt.
Das BVerfG musste sich nun mit der Fragestellung auseinandersetzen, ob die Mindestgewinnbesteuerung, die auf eine bloße zeitliche Streckung des Verlustvortrags ausgerichtet ist, bereits vom Grundsatz her nicht mit der Verfassung in Einklang steht und ob darüber hinaus in Konstellationen, in denen ein Definitiveffekt eintritt, ein Verfassungsverstoß vorliegt.
Gemäß der geltenden Rechtslage liegt bei Überschreiten des Sockelbetrags von 1 Mio. € und der Begrenzung des Abzugs darüber hinaus auf 60% bzw. 70% grundsätzlich eine Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen abhängig von der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte vor. Oberhalb des Sockelbetrags liegt eine formale Gleichbehandlung sämtlicher Körperschaftsteuersubjekte vor. Dies gilt unabhängig davon, ob die Körperschaftsteuersubjekte fortbestehen oder nicht, mithin unabhängig vom Eintritt eines Definitiveffekts.
Stellt das BVerfG bei seiner Prüfung eine Ungleichbehandlung fest, prüft es im nächsten Schritt, ob diese Ungleichbehandlung willkürlich erfolgt oder durch sachliche Gründe gerechtfertigt sein könnte. Die Mindestgewinnbesteuerung zielt auf die Gewährleistung eines gewissen Zugriffs des Staates auf gegenwärtige Unternehmensgewinne ab, indem Altverluste nicht unbeschränkt in Ansatz gebracht werden können. Durch die Regelungen werden die Steuereinnahmen des Staates verstetigt, wobei die Zahllast des Steuerpflichtigen gleich bleibt und diese nur in zeitlicher Hinsicht abweichend über die Veranlagungszeiträume verteilt wird. Somit liegt ein sachlicher Rechtfertigungsgrund in der Sicherung einer kontinuierlichen und gegenwartsnahen Besteuerung als besonderem Fiskalzweck vor.
Weiter führt das BVerfG aus, dass es sich bei der Mindestgewinnbesteuerung um eine verfassungsrechtlich zulässige typisierende Regelung handelt. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass juristische Personen eine unbegrenzte Lebensdauer haben und daher Verluste grundsätzlich zeitlich gestreckt verrechnet werden können und nicht untergehen. Auch die Wahl des Sockelbetrags des Verlustvortrags in Höhe von 1 Mio. € (sog. Mittelstandskomponente) knüpft an große Unternehmen an und macht die Vorschriften durch Nichteinbeziehung kleiner und mittlerer Unternehmen praktikabel und kann dadurch die Rechtsanwendung vereinfachen.
Zum Definitiveffekt führt das Gericht aus, dass der Gesetzgeber mit Blick auf das angestrebte Regelungsziel die Grenzen seiner Typisierungsbefugnis nicht überschritten hat. Es wohnt dem allgemeinen Unternehmerrisiko inne, dass der Steuerpflichtige kontinuierlich Gewinne erwirtschaften müsse, um vorhandene Verluste sukzessiv in Ansatz bringen zu können.
Die Vorteile der typisierenden Ausgestaltung der Mindestgewinnbesteuerung stehen nicht außer Verhältnis zu den mit ihr im Einzelfall verbundenen Härten infolge des Eintritts des Definitiveffekts. Ferner ist davon auszugehen, dass dieser Sonderfall nur eine kleine Anzahl an Steuerpflichtigen betrifft. Darüber hinaus lässt das Verfahrensrecht die Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen im Einzelfall zu.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das BVerfG die typisierenden Regelungen zum Verlustvortrag somit auch für die Fälle, in denen Verluste nicht mehr komplett mit künftigen Gewinnen verrechnet werden können, als verfassungsgemäß ansieht.
III. Fazit und Ausblick
Das BVerfG hat die Anwendung der Mindestgewinnbesteuerung bestätigt und keinen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG erkannt. Mit besonderer Spannung wurde eine Aussage zu den Fällen erwartet, die zu Definitiveffekten führen. Während in solchen Fällen aus guten Gründen von einer anderslautenden Entscheidung ausgegangen werden konnte, rückt das Gericht den typisierenden Charakter der Mindestgewinnbesteuerung in den Fokus und erkennt deswegen keinen Verfassungsverstoß. Die Regelungen zur Mindestgewinnbesteuerung sind demnach in der Praxis weiterhin relevant und müssen in der Liquiditätsplanung berücksichtigt werden. Sofern anhängige Rechtsbehelfsverfahren unter Bezugnahme auf das anhängige Verfahren beim BVerfG ruhten, ist davon auszugehen, dass die Finanzverwaltung die Einsprüche nun bearbeiten wird.
Mit Spannung zu erwarten ist die weitere Handhabe der Finanzverwaltung von Fällen mit Definitiveffekten. Da bereits das BVerfG Billigkeitsmaßnahmen erwähnte und eine Billigkeitsmaßnahme unter Berücksichtigung der besonderen Härte eines Definitiveffekts auch angezeigt erscheint, sollten betroffene Körperschaften einen entsprechenden Antrag erwägen, um die Folgen eines Definitiveffekts abzumildern oder gar zu beseitigen.